"Ich, Oskar
Schindler":
Briefe aus einem vergessenen Koffer
Andrea Übelhack
 |
"Schindlers Liste" - Steven Spielbergs Film, ausgezeichnet mit sieben Oscars,
hat vor einigen Jahren viel Aufsehen erregt. Der Film erzählt die wahre
Geschichte eines Geschäftsmannes, der sich im Laufe des Krieges zum Judenretter
wandelt.
Der Fall Schindler beschäftigt momentan in einem ganz anderen
Zusammenhang ein Stuttgarter Gericht.
Emilie Schindler, die Witwe von Oskar Schindler klagt gegen die "Stuttgarter
Zeitung" im Streit um den Nachlass ihres Mannes. |
1999 wurde im Haus der letzten Geliebten Oskar Schindlers, Ami Spaeth, ein
Koffer mit verschiedenen Dokumenten gefunden, darunter auch eine der berühmten
Liste mit den Namen der geretteten Juden. Die "Stuttgarter Zeitung" hatte über
den Koffer berichtet, einige Dokumente veröffentlicht und schließlich Koffer
samt Inhalt an die Gedenkstätte Jad waShem in Jerusalem übergeben.
Emilie Schindler sieht sich als Alleinerbin des Nachlasses ihres Mannes und
möchte daher durch die Zahlungs- und Unterlassungsklage Schadensersatz für
entgangene mögliche Einnahmen durch eine Veröffentlichung der Dokumente
erhalten.
Aufgrund des hohen Alters und der wirtschaftlichen Notlage
Emilie Schindlers empfahl das Gericht einen Vergleich, zu dem sich auch die
"Stuttgarter Zeitung" bereit erklärte. Die Parteien haben nun drei Wochen
Bedenkzeit.
Ob die Veröffentlichung des Nachlasses durch Emilie Schindler tatsächlich ein
Bestseller geworden wäre, sei dahingestellt. In jedem Fall bieten die Briefe und
Dokumente die Möglichkeit, eine umstrittene Persönlichkeit näher kennenzulernen
und Einblick in die Gedankenwelt Oskar Schindlers zu bekommen.
Erika Rosenberg, die Biografin von Emilie Schindler, erhielt alle Rechte, die
Briefe und Dokumente aus dem Koffer für ein Buch zusammenzustellen, das
schließlich im vergangenen Herbst beim Herbig Verlag erschien.
Die Korrespondenz aus dem Koffer beginnt nach Kriegsende und zeigt Schindlers
mühsamen Lebensweg nach seiner Auswanderung nach Argentinien 1949. Die
Herausgeberin untergliedert das Buch in verschiedene Themenbereiche, was zwar
einerseits sinnvoll erscheint, da so die verschiedenen Schwerpunkte aus den
Dokumenten herausgehoben werden. Andererseits sind einige Briefe und
Themengebiete so doppelt und dreifach abgedruckt und die zeitliche Einordnung
bedarf immer eines Blickes auf den Lebenslauf Schindlers im Anhang.
Die beiden bestimmenden Schwerpunkte in Schindlers Leben sind seine
Freundschaften und seine finanziellen und gesundheitlichen Probleme. Dem Thema
"Schindler und seine Freunde" widmet Rosenberg ein eigenes Kapitel. Zu seinen
engsten Vertrauten zählten auf jeden Fall viele ehemalige "Schindler-Juden", wie
Izak Stern, Jakob Sternberg, Moshe Bejski, Walter Pollack und Poldek
Pfefferberg. Vor allem mit dem ehemaligen Buchhalter aus der Emaillefabrik, Izak
Stern, verband Schindler eine tiefe Freundschaft.
Im April 1956 schreibt Schindler an Stern: "In unserem gemeinsamen "Gestern",
lieber Izak, war ich so erfüllt von der fanatischen Überzeugung der Richtigkeit
meiner Handlungen, als ich mich trotz aller Warnungen voll bewusst in eine Lage
brachte, aus der es kein Zurück gab, sondern nur ein Durchstehen unter Anwendung
aller Mittel, wie oft habe ich damals bei Dir Kraft geschöpft, in meiner inneren
Verzweiflung, bei Dir, dem Schwächeren, Bedrohteren, in Deiner edlen
Menschlichkeit, wo Dir Deine Gemeinschaft näher stand als Dein Ich." (S. 49 f.)
Schindler scheiterte sowohl in privater wie auch in geschäftlicher Hinsicht in
Argentinien. Seine finanzielle Lage wird seitdem zum ständigen Thema seiner
Korrespondenz, wobei er immer wieder seine Verbitterung darüber äußert, daß
gerade er, der im Krieg seinen Kopf und sein Vermögen hingehalten hat, in einer
solchen Lage ist: "Ich kenne einige "ganz Anständige", die heute wohl weit
besser leben als ich, die aber im kritischen Augenblick versagten, deren innerer
Schweinehund Oberhand bekam. Trotzdem hunderte Arbeiterinnen dieser Betriebe in
Stutthof ertranken, Männer in Mauthausen zu Tode geschunden wurden, schreiten
diese "ganz Anständigen" stolz erhobenen Hauptes durchs Leben" (S. 54)
Schindler kehrte schließlich 1957 nach Deutschland zurück, um dort
Entschädigungszahlungen aus dem Lastenausgleich zu bekommen und suchte immer
wieder nach Arbeitsmöglichkeiten, die in Verbindung mit Israel stehen sollten.
Dabei griff er immer wieder auf die Hilfe der ehemaligen "Schindler-Juden"
zurück, die ihm gerne jede erdenkliche Hilfe zukommen ließen. In einem Brief an
Stern schreibt er: "Lieber Izak, Du wirst gut verstehen, dass ich nur von
jüdischer Seite Förderung erleben darf (die obendrein kein Geld kostet), so
dadurch meine Position und mein Recht erlange. Als Bittsteller zu den neuen
deutschen Herren zu gehen (es sind ja doch die alten, nur leicht demokratisch
gefärbt und durch Marshallplan-Injektionen etwas aufgeblüht), ist mir unmöglich,
denn eine derartige Handlung würde mir als Bankrott meines Ichs und den Verlust
meines moralischen Sieges, den ich so teuer erkaufte, bedeuten." (S. 117)
1962 besuchte Schindler erstmals Israel und war vom begeisterten und herzlichen
Empfang, den ihm "seine Schindler-Juden" bereiteten, überwältigt. In einem
Dankes-Brief schreibt er, daß er seinen Freunden für diese herrlichen zwei
Wochen ewig dankbar sein werde.
Seine finanzielle Notsituation verbittert ihn jedoch zunehmend, v.a. auch
deshalb, weil, wie er schreibt, ehemalige SS-Generäle ihre Pensionen bekommen
während er sich mit existenzvernichtenden Erniedrigungen herumschlagen muß. Die
ständigen Geldsorgen macht er auch für seine steigenden gesundheitlichen
Probleme verantwortlich, was nicht zuletzt daran liegen wird, daß er sich keine
Krankenversicherung leisten konnte.
Über die letzten Lebensjahre Oskar Schindlers gibt der Inhalt des Koffers keine
Auskunft, es wurden keine Briefe aus den letzten Jahren darin gefunden. Er
scheint nur noch den Kontakt mit dem engsten Freundeskreis aufrecht gehalten zu
haben und lebte bei der Familie Staehr, die ihn bei sich zu Hause aufnahm.
Schindler starb am 9.10.1974.
Auf seinen Wunsch hin, wurde Oskar Schindler auf dem katholischen Friedhof am
Zionsberg in Jerusalem bestattet. Sein Grab ist Millionen Zuschauern aus der
Schlußszene von Spielbergs Film bekannt.
Auch der Film hat im übrigen eine interessante Vorgeschichte, die sich aus den
Koffer-Fundstücken nachvollziehen läßt. Die erste Idee der Verfilmung von
Schindlers Geschichte stammt von stammte von jüdischen Freunden aus Amerika,
darunter Poldek Pfefferberg alias Paul Page, die den nach Amerika emigrierten
Regisseur Fritz Lang 1951 darauf ansprachen. 1963 erfuhr dann der amerikanische
Filmproduzent Martin Gosch von Schindler, wieder durch die Vermittlung von
Pfefferberg, worauf es Ende 1964 auch zu einem Vertragsabschluß kam. Leider
wurde die Verfilmung nicht realisiert, Schindler hätte neben der privaten
Bestätigung auch den finanziellen Erlös dringend benötigt. Erst 1994, 20 Jahre
nach Schindlers Tod, drehte Steven Spielberg die Geschichte der
"Schindler-Juden".
Erika Rosenbergs Auswahl aus den Briefen und Dokumenten des Koffers eröffnen den
Blick auf eine facettenreiche Persönlichkeit. Schindler war ein Mann, der immer
sehr genau darauf geachtet hat, wie die Leute über ihn denken, der seine
Freundschaften pflegte und sie auch in Anspruch nahm. Kein einfacher Mensch,
nicht einfach zu verstehen. Ein "Gerechter", dessen Lebensweg nach dem Krieg vor
allem eine Geschichte von Enttäuschungen, Mißachtungen und Notlagen ist.
Anm. (dg): Während ihres letzten Aufenthalts in Bayern erwähnte Frau
Schindler (93), sie würde ihre letzten Lebensjahre gerne in einem
Altersheim verbringen.
Sehr gerne bliebe sie in Regensburg, wo sie nach dem Krieg einige Jahre
zugebracht hatte. Durch ihre schlechte finanzielle Situation könne sie
sich ein solches Heim jedoch nicht leisten. Kein Politiker, weder in
Bayern, noch sonstwo in Deutschland fand sich zuständig, Frau Schindler
eine Unterstützung zuzusagen.
Ganz im Gegensatz dazu lebte Anton Malloth, einer der schrecklichsten
SS-Verbrecher des Lagers Theresienstadt, in Pullach b.München jahrelang
in einem Altersheim des paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Während er
Sozialhilfe erhielt standen ihm zudem die Einnahmen aus seinem
Mehrfamilienhaus in Meran zur Verfügung. Die Tochter Heinrich Himmlers,
Reichsführer SS, kümmerte sich persönlich um das Wohlergehen des
"schönen Toni". Seit einem Jahr sitzt
Anton Malloth in der JVA München-Stadelheim.
haGalil onLine 07-05-2001
- In Schindlers Schatten
Emilie Schindler erzählt ihre Geschichte
KIWI 5.ed. '99 tb DM16.90
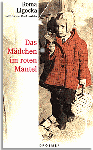
-
Das Mädchen im roten Mantel
von
Roma Ligocka
In Krakau wird 1938 ein
kleines Mädchen geboren, während in Deutschland die Synagogen brennen.
Sie ist noch kein Jahr alt, als ihre Eltern den Judenstern tragen
müssen. Die erste Realität, die sie kennenlernt, ist die Realität des
Grauens - für sie die Normalität: Ihre Welt besteht aus Schreien,
Schüssen und Toten.
Mit den Augen eines Kindes beschreibt Roma Ligocka, wie aus einer
Kindheit, die behütet und wohlhabend hätte sein sollen, ein Alptraum
wird. Kurz vor der Liquidierung des Krakauer Ghettos kann sie mit ihrer
Mutter fliehen. Der rote Mantel des Mädchens rettet ihnen das Leben,
weil "die kleine Erdbeere" eine polnische Familie so rührt, dass sie den
beiden Unterschlupf gewährt. Mit falschen Papieren und blond gefärbten
Haaren überlebt die kleine Roma die Nazi-Zeit.
Im stalinistischen Polen kommt sie mit vielen bedeutenden Literaten
und Künstlern in Kontakt, auch aus dem polnischen Widerstand. Geprägt
durch dieses künstlerische Milieu emigriert sie nach Deutschland. Viele
Jahre später sieht sie in Spielbergs Film Schindlers Liste die berühmte
Szene mit dem kleinen Mädchen im roten Mantel. Da bricht die Erinnerung
durch und sie erkennt sich wieder: Sie ist dieses Mädchen.
Die außergewöhnliche Geschichte einer sensiblen und begabten Frau
zwischen den Schatten einer traumatischen Kindheit und einem farbigen
Künstlerleben. Eindrucksvoll und vor allem gefühlsvoll ist die
Schilderung der Kindheitsjahre. Man wird von der Hoffnung auf ein Ende
der Verfolgung mitgerissen und freut sich, wenn es soweit ist. Doch dass
das Leben nicht aus Heldentum und Happy End besteht wird einem
spätestens klar, wenn die Nachkriegsjahre beschrieben werden.
Dieses Buch ist vor allem biographisch und hat somit ein Großteil
der Bitterkeit des Lebens in sich und macht einem somit klar, dass trotz
aller Freude über das Ende des zweiten Weltkrieges die Welt nicht in
Ordnung war und auch, dass Überwindung kein Ereignis, sondern ein
Prozess ist. Wer also Lust hat, sich nicht nur Unterhalten zu lassen,
sondern auch etwas über das Leben zu erfahren, der ist mit diesem Buch
gut beraten, zumal es ebenso die Schrecken des NS-Regimes, wie auch die
Taubheit der Nachkriegsjahre treffend beschreibt.
Das alles ist passiert, es ist kein Hollywoodfilm und es hat kein
Ende, weil es noch nicht zuende ist. Das Leben geht weiter...
|