| What do they tell about us -
Was sagen sie über uns ? In den
englischsprachigen Ländern gibt es im Bereich der "Ethnic Studies"
seit einigen Jahren Diskussionen zur Fragestellung: "What do they
tell about us"? Gemeint ist damit, was Angehörige der
Mehrheitskultur ("they") über Minderheiten ("us") sprechen: Was wird
wie erzählt, was wird verschwiegen, verdrängt und ausgeblendet.
Welche Bilder und Stereotypen über Minderheiten werden
weitergegeben? Welche Machtverhältnisse spiegeln sich in den
Darstellungsweisen? In Deutschland ist diese Debatte über ihre
Anfänge noch nicht hinausgekommen (Bilder von Schwarzen). HaGalil
online wird dieser Fragestellung in einer Serie nachgehen, wobei es
naheliegenderweise um die Darstellung von Juden, jüdischem Leben und
jüdischen Traditionen gehen wird. Angehörige anderer
Minderheitsgruppen können sich gerne an diesem Diskurs beteiligen
und uns Beiträge schicken.
Teil 2: Im botanischen Garten bei den "Pflanzen
der Bibel"
Das Jahr 2003 haben die beiden großen Kirchen
zum "Jahr der Bibel" erklärt und unterschiedliche Aktivitäten
initiiert. Dabei wurde weitgehend "vergessen", daß - was aus
christlicher Sicht der erste Teil der Bibel ist - dort "Altes
Testament" genannt - in der jüdischen Tradition verwurzelt ist und
dort eine andere Auslegung und Entwicklung hat als im Christentum.
Nur in Sachsen-Anhalt gab es mit dem dortigen Landesrabbiner eine
Kontroverse, weil dieser nicht hinnehmen wollte, daß Juden sozusagen
aus ihrer eigenen Tradition ausgesperrt und unsichtbar gemacht
werden und öffentlich so getan wird, als ob das Deutungsmonopol über
die Inhalte des Tenach ("ersten Testaments") bei den Christen liegt.
Um so erfreulicher ist es, daß der Botanische
Garten in Berlin in Zusammenarbeit mit dem ökumenischen
Frauenzentrum Evas Arche eine Reihe zu "Pflanzen der Bibel"
anbietet. Bei dem vierten Rundgang am 26. Juli 2003 lautete der
Ausschreibungstext:
"Duft - der göttliche Odem. Vortrag und
Spaziergang mit Wohlgerüchen
Wohlriechende Düfte von biblischen Ölen, wie Myrte, Ladanum, Myrrhe,
Aloe und Zimmet einzuatmen, bedeutet ein Sinnenerlebnis besonderer
Art. Düfte können belebend oder beruhigend, süß oder herb sein. Um
Atem und Odem geht es in alten Geschichten. Es heißt, dem Menschen
wurde das Leben eingehaucht durch den Odem Gottes. Der Atem, der
Odem, der Duft ist, der uns und unseren Geist beflügelt"
Die Referentin, Rosemarie Gebauer ist
Diplombiologin und beschäftigt sich seit 9 Jahren mit Pflanzen der
Bibel und anderen Themen zur Kulturgeschichte der Pflanzen und
bietet diese im Rahmen der "Pflanzenkultouren"-Führungen an.
Ausgangspunkt war eine Alltagserfahrung, die jedem
bekannt ist: Man riecht einen Duft und wird dadurch an eine
vergangene Situation erinnert. Dafür ist das Duftgedächtnis
verantwortlich. Ein Text von Ulrich Rückert (1788-1866) kommt zu dem
Fazit, daß die "Pflanze sich selbst quasi abschafft". Wir hören von
der biblischen Schöpfungsgeschichte und werden ausführlicher auf die
Parallele in der griechischen Mythologie (Prometheus und Athene)
sowie in der nordischen Mythologie (Edda) hingewiesen.
Danach gibt es dann Textzitate von Stephan George
und Friedrich G. Klopstock. Wer erwartet hatte, daß der Schwerpunkt
des Rundgangs auf den biblischen Traditionen und Konzepten liegt,
wurde enttäuscht. Denn die Erwähnung der "Pflanzen der Bibel" und
kurze Textzitate dienten mehr als Aufhänger für alle möglichen
anderen literarischen Texte.
Weiter ging es zum Aspekt "Düfte und Verführung".
In den Sprüchen Salomons ist an einer Stelle die Rede von der Hure
Babylon. In verschiedenen Kulturen gibt es den Brauch - und dafür
gibt es auch biblische Beispiele - das Bett zu besprengen. Auch das
Hohelied findet Erwähnung. Dann stellt die Referentin selbst die
Frage: "Wer würde schon sagen Gott verführt?" und wollte damit das
ihrer Meinung nach schwierige Verhältnis von Religionen und Erotik
thematisieren. Nun genau das aber tut die biblische Tradition -
zumindest nach jüdischer Auslegung. Gott wird immer wieder als
Liebhaber gesehen. Erstaunlich, daß jemand, der gerade selber das
Hohelied zitiert hat, das nicht weiß.
Zwischendurch konnte man an unterschiedlichen
Duftproben riechen. Wir erfuhren vom heiligen Salböl, daß
Räucheropfer gebracht wurden, damit Gott Gebete erhört, daß Priester
und die Stiftshütte gesalbt wurden und auch Jesus bevor er ins Grab
gelegt wurde mit Leintüchern mit Düften umhüllt wurde. Auf Josef und
seine Brüder von Thomas Mann wurde verwiesen, denn als Josef an die
Ismaeliten verkauft wurde, führten diese Händler unterschiedliche
Produkte mit sich - darunter auch Duftstoffe. Hier hätte es - bei
entsprechender Vertiefung - interessant werden können, denn diese
Produkte sind symbolisch für die Unterschiedlichkeit kultureller und
religiöser Konzepte der Ismaeliten.
Kreuz und quer ging es durch biblische und mehr
noch durch andere Kulturen. Vieles wurde kurz erwähnt und manchmal
zitiert aber nichts vertieft, ob es nun darum ging, daß Paulus vom
"Wohlgeruch des Evangeliums" sprach oder im nächsten Satz die
Ägypter dran waren, bei denen die Götter die Quelle des Wohlgeruchs
waren und der Weihrauch aus dem Auge der Osiris kommend gesehen
wurde. Im Anschluß daran wurde auf den Taufritus der Christen
verwiesen, denn in einigen christlichen Gemeinschaften ist dieser
mit einer Salbung verbunden und in manchen Kirchen wird die Salbung
neu entdeckt.
Weiter ging es zu Jesus Sirach, eine apokryphe
Schrift, die einhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung entstand und
die Rose von Jericho erwähnt, von der es auch ein Bild in der
Gemäldegalerie von Botticelli gibt. Von einer hundert blättrigen
Rose, die über das osmanische Reich im 16. Jahrhundert nach Europa
gekommen war, hörten wir dann auch noch. Und irgendwie landeten wir
beim Garten Salomons und bei Dantes göttlicher Komödie.
Zum Schluß kamen wir bei der Myrte an. Richtig
ist, daß der Duft dieser Pflanze mit dem Schabbatausgang verbunden
wird - so die jüdischen Gelehrten im 1. Jahrhundert. Der Duft der
Myrte "trug die Juden über die Werktage", denn "der Schabbat war das
Paradies. Die Werktage waren die Hölle" - eine Schlußfolgerung die
der jüdischen Tradition fremd ist, betont sie doch, daß beides
zusammengehört und wie wichtig die klare Trennung ist. Und auch wenn
der Schabbat uns etwas von der zukünftigen Welt zeigt, so sind die
Wochentage nicht "Hölle", sondern sie sind uns als Möglichkeit
gegeben, unseren Beitrag zur Gestaltung der Welt zu leisten.
Verabschiedet wurden wir schließlich mit der falschen Behauptung:
"Myrte und Rose waren die wichtigsten Düfte der Juden damals wie
heute".
Fazit: Von jedem ein Häppchen, aber nichts richtig
und was man über biblische Traditionen soweit sie das Judentum
betreffen, erfahren hat, war dürftig und großenteils durch
Fehlwahrnehmungen der Referentin geprägt.
"Die sieben Pflanzen Israels"
war der Titel der Folgeveranstaltung, die vierzehn
Tage später wieder als Kooperation des Botanischen Gartens Berlin
und des ökumenischen Frauenzentrums Evas Arche stattfand.
"Sieben Pflanzen bzw. deren Früchte werden
besonders häufig in der Hebräischen Bibel und im Neuen Testament
erwähnt. Ihnen kommt eine große Bedeutung besonders in den
Gleichnissen zu. Es sind Pflanzen, die uns heute aus dem Alltag sehr
vertraut sind. Als Pflanzen der Bibel geben sie uns einen Einblick
auf den damaligen Speiseplan über Anbau und Pflege der Bäume und
Felder sowie deren symbolische Bedeutung."
Bei den "sieben Arten" handelt es sich um die
Pflanzen bzw. deren Früchte, die im Zusammenhang mit der Verheißung
des Landes genannt werden und deshalb einen besonderen Stellenwert
haben:
"Der Ewige, dein Gott bringt dich in ein gutes Land, ... in ein Land
des Weizens und der Gerste, des Weins und der Feige und Granate, in
ein Land der Ölbeere und des Honigs" (5 Mose 8,8), ist die biblische
Textgrundlage.
Die sieben Pflanzen - so erfahren wir - kommen im
ganzen Mittelmeerraum vor, bei den Römern, bei den Ägyptern und eben
auch bei den Israeliten. "Da gibt es keinen Unterschied". In der
Tatsache, daß diese sieben Arten in allen diesen Kulturkreisen
bekannt sind, wohl nicht, aber wie sie in den jeweiligen Welt- und
Gottesbildern interpretiert werden sehr wohl. Wir erfahren nichts
darüber, daß in der jüdischen Tradition die sieben Arten und wie sie
gedeutet werden, diese als spezifische Repräsentanten des
Monotheismus gesehen werden und Israel sich damit inhaltlich sehr
wohl von den Umgebungskulturen unterscheidet.
Im Judentum spielt die mündliche Tradition eine
bedeutende Rolle, mit deren Hilfe die schriftliche Tradition (Torah)
interpretiert wird. Ohne diese mündliche Tradition (Talmud) ist ein
Verständnis der schriftlichen nicht möglich. Im Talmud behandeln
ganze Traktate den Umgang mit Pflanzen, ihre Bedeutung, Anbau,
Pflege, Heilwirkungen etc. Daß es eine solche mündliche Tradition
gibt, war in beiden Veranstaltungen nicht einmal eine Erwähnung wert
und das, obwohl der Titel und die Beschreibung nahelegen, daß das
Verständnis der jüdischen Tradition erschlossen werden soll.
Rosemarie Gebauer weist darauf hin, wie wichtig es
für die Entwicklung dieser sieben Arten sei, daß zwischen dem
"Passafest und dem Wochenfest, das sieben Wochen später stattfindet
die Winde aus der richtigen Richtung kommen". "Am Wochenfest wurden
dann die Erstlinge im Tempel dargebracht". Eine Teilnehmerin kann
mit dem Begriff "Wochenfest" nichts anfangen und fragt nach, was
damit gemeint ist und was da gefeiert wird. Das weiß die Referentin
auch nicht, nur "daß es ganz wichtig ist" und "um Ostern herum
stattfindet".
Die sieben Pflanzen Israels repräsentieren "die
Gratwanderung des Volkes Israels". Abgesehen davon, daß das falsch
ist, stellt sich die Frage, was damit gemeint sein könnte. Erklärt
wird es nicht, aber vielleicht wird es deutlicher, wenn die
einzelnen Pflanzen dran sind? Jetzt werden wir darauf hingewiesen,
daß im Psalm 104 vier von diesen Früchten genannt werden, die
innerhalb der sieben Arten noch einmal einen besonderen Stellenwert
haben, weil "sie in jeder Messe auf dem Altar und auch beim Schabbat
auf dem Tisch stehen". Erwähnt sind im Psalm 104 (Vers 15ff) Brot,
Wein, Öl und Zeder, wobei letztere weder zu den sieben Arten gehört
noch einen Bezug zum Schabbat hat.
Der Ölbaum kommt über 150 Mal in
der Bibel vor. Aus diesem häufigen Vorkommen lassen sich 8 Kapitel
zusammenstellen wie "Alltag und Kulturgeschichte". Die sieben
anderen möglichen Kapitel erfahren wir nicht, aber wir begeben uns
mit Abraham - er heißt wie der Stammvater der drei monotheistischen
Religionen - auf eine Zeitreise zu seinem Alltag als Olivenbauer.
Aus biblischen Zitaten läßt sich der Tageslauf eines Olivenbauers
beschreiben und auch die jahreszeitlichen Abläufe des Olivenanbaus,
von denen es an die 40 Sorten gibt. Sogar Probleme mit Schädlingen
werden benannt wie beim Propheten Amos.
Bilder von der "Rückkehr der Taube" (Noah), "den
10 klugen und den 10 törichten Jungfrauen" (Neues Testament) und die
Abbildung einer Öllampe aus biblischen Zeiten werden gezeigt. Das
Bild, das Paulus im Römerbrief (Kapitel 9 bis 11) vom Ölbaum
verwendet, wird erwähnt.
Paulus vergleicht dabei die Christen mit
Ölzweigen, die einem alten Ölbaum (gemeint ist Israel) eingepropft
werden. Aber über diese Erwähnung geht es nicht hinaus. Gerade der
Ölbaum könnte als Grundlage dienen, um deutlich zu machen, welche
theologischen Konzepte mit Pflanzen verbunden sind und welche große
Bedeutung von daher den Pflanzen in der Bibel zukommt. Was sagen sie
über die vordergründig wörtliche Bedeutung hinaus zum Verhältnis von
Gott und Menschen oder von Menschen untereinander oder auch über den
Umgang vom Menschen mit der Natur usw.
Gerade das Beispiel von den Ölzweigen im
Römerbrief zeigt, wie weitreichend die Theologie war, die aus diesem
Pflanzenbeispiel abgeleitet wurde, nämlich die heute noch in vielen
christlichen Kreisen gängige Terminologie von Gesetz (gemeint ist
Judentum) und Gnade (Christentum), wobei das Judentum die dunkle
Folie bildet, von dem das Christentum sich dann umso strahlender
abhebt. In einer Lutherbibel aus dem Jahr 1932 ist vor dem 10.
Kapitel als Überschrift eingefügt: "die Juden haben ihre eigene
Gerechtigkeit gesucht und darum die Gerechtigkeit aus dem Glauben
nicht gefunden". Christlicher Antijudaismus hat sich über
Jahrhunderte immer wieder auf diese Kapitel aus dem Römerbrief
bezogen und daraus eine "Enterbungstheologie" konstruiert, für die
der Gegensatz zwischen "Altem Bund" (Israel) und "Neuem Bund"
(Christentum) von entscheidender Bedeutung war. Der alte Bund wurde
- nach dieser Sicht - vom neuen Bund abgelöst.
Immer wenn es interessant werden könnte im
Hinblick auf die Ideen und Konzepte, die hinter den Bäumen, Früchten
und Pflanzen der Bibel stehen, geht es schon weiter zur nächsten
Erwähnung. Überhaupt ist alles immer nur eine Erwähnung wert Wir
hüpfen so quasi von einer Erwähnung zur nächsten.
Von den Ölzweigen im Römerbrief geht es zum Öl in
der Menora (Leuchter im Tempel) und zur Funktion des Öls als Salböls
für Priester. Im nächsten Satz sind wir im Buch Ruth, denn Noemi hat
ihre Schwiegertochter Ruth bevor sie zu Boas ging aufgefordert, sich
zu baden und salben. Wir hüpfen zurück in den Tempel zu dem Hinweis,
daß eine Hebe für Priester und Leviten zu entrichten war.
Das Thema Wein wird eingeleitet
mit einem Bild von "Jesus in der Kelter" und einem Text aus Jesus
Sirach, einem apokryphen Text aus dem ersten Jahrhundert vor unserer
Zeitrechnung. Jesus Sirach vergleicht damit die Qualität des Weines
mit der Qualität eines Freundes: Je länger man einen Freund hat,
desto mehr schätzt man ihn. Schließlich kommen wir auch noch zu
biblischen Bezügen, nämlich den Segen von Jakob für seinen Sohn
Juda: "Sein Füllen knüpft er an den Weinstock und an die Rebe seiner
Eselstute Junges, er wäscht im Wein sein Kleid, im Blut der Trauben
sein Gewand. Die Augen dunkler als Wein, die Zähne weißer als
Milch". Darauf folgt das Weinbergslied des Propheten Jesaja, in dem
geschildert wird, wie ein Weinberg angelegt und gepflegt wird und
das Volk Israel mit einem Weinberg verglichen wird.
Bei Israel Löw, der in den 30iger Jahren ein
vierbändiges Werk zu Pflanzen der Bibel veröffentlicht hat, findet
sich die Geschichte von einem Fuchs, der in einen Weinberg
eindringen will. Er findet nur ein kleines Loch im Zaun und muß drei
Tage fasten, damit er durch das Loch schlüpfen kann. Er frißt sich
mit Trauben voll und ist dann zu dick um wieder durch das Loch
zurückzuschlüpfen. Wieder muß er drei Tage fasten bis es klappt.
Daraus zieht er den Schluß, den er den Weinberg mitteilt: "von dir
hat man nichts". Es sei wie mit dem Leben: Man kommt ohne etwas auf
die Welt und muß sie wieder ohne alles verlassen.
Nun wird die "soziale Komponente" des Weins
erläutert: Für die Leviten, die Armen und Waisen wird ein bestimmter
Anteil abgegeben. Nachlese darf im Weinberg nicht gehalten werden.
Die Kundschafter mußten den Wein wegen seiner Größe mit Hilfe einer
Stange transportieren. Und die Hochzeit zu Kana (Neues Testament)
zeigt, welche Bedeutung Wein bei sozialen Ereignissen hat. Zuviel
sollte man allerdings nicht zu sich nehmen. Die Bibel warnt vor
Trunkenheit und stellt uns Noah aber auch Lot als warnendes Beispiel
vor (Sodom und Gomorra). Allerdings steht es im biblischen Bericht
anders herum: Sodom und Gomorra werden vernichtet. Um
Nachkommenschaft zu haben, versetzen die Töchter Lots ihren Vater in
Trunkenheit. Später als wir eine Weinpflanze sehen werden, wird noch
auf die wesentliche Funktion des Weins für das Abendmahl hingewiesen
und daß es beim Schabbat einen Kiddusch (Segen über den Wein) gibt.
Die für das soziale Leben eminent wichtige Komponente, daß Wein
koscher sein muß, kam überhaupt nicht vor.
Mit der Erschließung der Feige
läuft es dann auch nicht besser. Sie gehört zu den Anfängen der
Bibel, zu Adam und Eva im Garten. Davon gibt es viele Darstellungen
in der bildenden Kunst wie ein Gemälde von Dürer. Wir sehen mehrere
Darstellungen. Vor dem 16. Jahrhundert bedecken Adam und Eva ihre
Blöße mit anderen Blättern denn bis zu diesem Zeitpunkt wußte man in
der europäischen Kunst nicht, wie Feigenblätter aussehen. Diese sind
so quasi die "erste Ökokleidung".
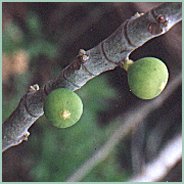
Photo: Marion Keunecke,
Berlin |
In biblischen Texten ist von Feigen in ihren
unterschiedlichen Stadien (Frühfeigen - Jesaja) die Rede. Johannes
vergleicht in der Apokalypse das Herunterfallen der Sterne des
Himmels mit Feigen die auf die Erde fallen und der Evangelist
Matthäus erzählt von Feigen und Disteln. Der Prophet Micha verwendet
Wein und Feige als Friedenssymbol. Leider erfahren wir nichts
darüber, welch hohen Stellenwert die Feige in der jüdischen
Tradition als Symbol für Weisheit und Lernen hat. "Die Feige wird in
der Bibel positiv und negativ geschildert, der Ölbaum immer
positiv". Das mag für die christliche Tradition gelten, denn im
Neuen Testament kommt der Feigenbaum in Gleichniserzählungen vor. Da
er in der erwarteten Zeit keine Frucht trägt, wird er umgehauen und
ins Feuer geworfen. In der jüdischen Tradition gibt es eine solche
Erzähltradition nicht. Es kann sie auch nicht geben, weil der Mensch
immer eine Chance zur Umkehr hat. Weil darüber aber nicht gesprochen
wird, entsteht bei den Zuhörern eine Gleichsetzung von jüdischer und
christlicher Tradition, obwohl der Feigenbaum im Judentum nur
positiv besetzt wird.
Auch über den Weizen gibt es
zahlreiche Gleichnisse im Neuen Testament, wenn von Saat und Acker
die Rede ist. Mehrmals wird betont: "Jesus war botanisch gesehen
total korrekt". Auch im Buch Ruth spielt Weizen eine zentrale Rolle,
geht es doch um die Zeit der Weizenernte. Ruth war Ausländerin und
suchte mit ihrer Schwiegermutter ein besseres Leben "in Betlehem,
was Stadt des Brotes heißt". Ist zwar nicht ganz richtig, aber auch
nicht ganz falsch, was man über die meisten Bezüge, die in diesem
Rundgang zu jüdischer Tradition hergestellt werden, sagen kann. So
geht es auch gleich damit weiter, daß der beliebte Hochzeitsspruch
"wo du hin gehst, da gehe auch ich hin" aus diesem biblischen Buch
stammt. Und nicht nur Boas habe auf der Tenne geworfelt, sondern
auch Jesus. Durch die Heirat mit Boas kommt Ruth in den Stammbaum
des Messias.
Ob das Manna nicht auch zu den sieben Pflanzen
Israels gehört, will eine Teilnehmerin wissen. Nein, das Manna sei
das Sekret einer Laus, die auf Tamariskenbäumen lebt. Da aber "Jesus
als Brot des Himmels bezeichnet wird und Manna auch als Brot des
Himmels bezeichnet wird, gehört es schon irgendwie auch dazu"
erfahren die Zuhörer.
Die Gedankensprünge von Boas zu Jesus und zum
Manna unterstellen eine Gleichsetzung christlicher und jüdischer
Tradition, die nicht existiert und die keiner der beiden Traditionen
gerecht wird.
Dann werden einige Kostproben gereicht: Oliven,
Wein, Feigen, Granatapfelsirup und Mazzen, "die aus Weizen und
Wasser und ohne Hefe sind". Was es damit auf sich hat und wo die
Mazzen im Judentum ihren "Sitz im Leben haben" erfährt man nicht.
Nun haben wir Gelegenheit einen Feigenstrauch zu
sehen und eine durchgeschnittene Feigenfrucht im Anfangsstadium.
Dann geht es weiter zum
Granatapfel, dessen Kelch orange
ist und nicht grün. Er spielt in allen Kulturen des Orients eine
Rolle. Er sieht aus wie ein Apfel mit Krone - erinnert also an den
Reichsapfel. In ihm sind viele Früchte. Sie werden mit Maria und
ihren zahlreichen Tugenden verglichen.
In der Bibel kommt der Granatapfel "nur im Alten
Testament vor" nicht im Neuen - und zwar bei der Beschreibung der
Kleidung des ersten Priesters Aaron - und wenn es um den Bau des
Tempels geht. Zum Granatapfel gäbe es sechs Stellen in der Bibel -
da wurden wohl nur die im Hohenlied gezählt.
Viel Zeit bleibt uns jetzt nicht mehr für die
Dattelpalme, denn in Kürze wird der botanische
Garten geschlossen, und wir hören bereits die Klingel, die darauf
hinweist. Eigentlich ist die Dattel die Pflanze des Koran.

Photo: Marion Keunecke,
Berlin |
In der Bibel kommen Palmen in der Wüste vor. Als
die Israeliten bei Elim rasteten (2 Mose 25), sahen sie 70
Dattelpalmen. Aber nicht nur da - möchte man hinzufügen. Palmen
werden im Tal von Jericho erwähnt und auch auf Bergen, wobei die
mündliche Tradition darauf hinweist, daß die Qualität der Früchte
von Palmen, die auf Bergen wachsen, schlechter sei. Deswegen dürfen
sie auch nicht für die Darbringung der Erstlinge verwendet werden.
Aber die reiche mündliche Tradition des Judentums zu den Pflanzen
der Bibel war ein Stiefkind dieser Führung.
Wir hörten vom Einzug von Jesus in Jerusalem, der
durch Palmwedel geehrt wurde, die vor ihm ausgebreitet wurden. In
der bildenden Kunst findet man immer wieder Heilige, die mit einem
Palmwedel dargestellt sind, womit gezeigt wird, daß es sich um
Märtyrer handelt.
Aber zumindest wurde die Stelle im Psalm 92 vom
Gerechten, der wie ein Palmbaum ist, erwähnt, daß Deborah unter
einer Palme richtete und auch noch der Lulaw, der Feststrauß zum
Laubhüttenfest. Würde ihn allerdings so zusammenstellen wie
Rosemarie Gebauer ihn schilderte, so wäre er nicht vollständig und
damit nicht verwendbar.
Fazit: Dadurch, daß so viel und so
Unterschiedliches erwähnt wurde, mag der Eindruck entstehen, man
habe viel gelernt. Allerdings: Quantität vermag Qualität nicht zu
ersetzen und an der Substanz mangelte es erheblich. Wer damit
zufrieden ist, zu den Pflanzen der Bibel entsprechende Bibelstellen
und Abbildungen vorgestellt zu bekommen und das lieber im
Botanischen Garten tut als drinnen, mag damit zufrieden sein. Wer
etwas über "Pflanzen der Bibel" erfahren will, was über Erwähnungen
und Andeutungen hinausgeht, ist hier falsch.
Iris Noah
What do they say about us?
Teil 1:
"gehen & sehen" ein Stadtrundgang
Teil 3:
Judensonntag - Tag der Judenmission -
Israelsonntag
Teil 4:
Israelsonntag:
Jesus weint über Jerusalem
Teil 5: Im Kino - Rosenstrasse
Teil 6:
Black Atlantic - Schwarze
in Deutschland
Zum Weiterlesen:
Warum wird das Judentum so oft missverstanden?
Anne-Frank-Zentrum Berlin:
Jüdisches Leben in Berlin: - nur eine Assoziationslandschaft?
hagalil.com
31-07-03 |